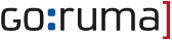Vor dem Jahr 1000
Die Besiedelung des amerikanischen Kontinents erfolgte vermutlich zwischen 30.000 und 8.000 v. Chr. von Nordost-Asien über eine Landbrücke (Beringland) an der Stelle der heutigen Beringstraße. Von Alaska aus wurde der gesamte Doppelkontinent in mehreren Wellen bis nach Feuerland besiedelt. Der älteste gesicherte archäologische Fund stammt aus Chile und wird mit 13.800 v. Chr. datiert.
Die Ureinwohner Amerikas entwickelten in Mittel- und Südamerika städtische Hochkulturen. In Nordamerika, dem Gebiet der heutigen USA bzw. Kanadas, gründeten sie im östlichen Einzugsgebiet des Mississippi komplexe Gemeinwesen, sog. Templemound-Kulturen. Diese zerfielen noch vor Ankunft der Europäer. An ihre Stelle traten kleinere dörfliche Gemeinschaften, die in der Hauptsache vom Ackerbau lebten. Im Südwesten der heutigen USA entstanden teilweise mehrstöckige Lehmbausiedlungen mit bis zu 500 Räumen, die Pueblos. Die Geschichte der amerikanischen Ureinwohner wurde zum größten Teil mündlich überliefert. Tatsachenberichte und Mythen gehen hierbei oft fließend ineinander über. Allerdings bewiesen archäologische und geologische Funde zuletzt, dass die sogenannte indianische "oral history" Ereignisse bewahrt hat, die viele Jahrhunderte zurückliegen.
Vom Jahr 1000 bis zum 17. Jahrhundert
Um das Jahr 1000 erreichten die Wikinger unter ihrem Anführer Leif Erikson den Norden des amerikanischen Kontinents. Sie gründeten im heutigen Neufundland, das sie Vinland nannten, eine Niederlassung. Heute gilt Christoph Kolumbus, der im Jahre 1492 zum ersten Mal amerikanischen Boden betrat, als Entdecker Amerikas. Die folgende Inbesitznahme und wirtschaftliche Erschließung des nordamerikanischen Kontinents war von Rivalitäten zwischen den europäischen Handelsmächten Spanien, Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden geprägt. Mitte des 16. Jahrhunderts begannen europäische Einwanderer Nordamerika zu besiedeln. 1565 gründeten spanische Siedler im heutigen St. Augustine in Florida die erste europäische Siedlung auf dem Kontinent.
Die erste englische permanente Siedlung wurde in Jamestown am James River im US-Bundesstaat Virginia am 13. Mai 1607 gegründet. Jamestown liegt ca. 250 km südlich von Washington. Ihren Namen erhielt die Siedlung später nach König James I. bzw. Jakob (1566-1625), dem Nachfolger von Königin Elisabeth I. (1533-1603).
Im 17. Jahrhundert führten wirtschaftliche Missstände in Europa mit Verarmung der Landbevölkerung und hoher Arbeitslosigkeit in den Städten zu großen Einwanderungsströmen. Viele der Einwanderer waren Puritaner. In Virginia entstand mit Jamestown die erste englische Siedlung im Jahre 1606. Eine große Immigrationswelle folgte 1620 mit der Mayflower im heutigen Massachusetts durch die sogenannten Pilgerväter. Sie gründeten die Siedlung Plymouth. 1630 entstand eine größere Siedlung in der Region des heutigen Boston. Bereits 1635 wanderte ein Teil der dortigen Siedler auch in das Gebiet von Connecticut aus.
Die englischen Kolonien entwickelten auf dem amerikanischen Festland drei Hauptregionen: Der Süden (Maryland, Nord und South Carolina, Virginia, Georgia) wurde durch Plantagenwirtschaft (Tabak, Reis) und Sklaverei geprägt. In den Neuenglandkolonien (Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire) blühten v.a. Handel, Fischerei und Schifffahrt. Die dritte Region bildeten die Mittelatlantikkolonien (New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware), in denen sowohl Handel als auch Landwirtschaft betrieben wurde.
Die Zahl der zur Zeit der Ankunft der Europäer in Nordamerika lebenden Ureinwohner betrug heutigen Schätzungen zufolge etwa drei Millionen. Viele indianische Stämme wurden bereits zu Beginn der Kolonialzeit durch eingeschleppte Infektionskrankheiten (v.a. Pocken) dezimiert. Im 17. Jahrhundert begannen Vertreibung und Vernichtung der Indianer durch die europäischen Kolonialisten, deren vollständiges Ausmaß der Öffentlichkeit bis heute nicht bekannt ist. Um die Ermordung der Ureinwohner möglichst unbedeutend erscheinen zu lassen, wurden die Einwohnerzahlen für die Zeit vor 1492 von amerikanischen Behörden bis in das 20. Jahrhundert hinein heruntergespielt. Im Jahre 1890 registrierte der US-Zensus noch knapp 240.000 in den USA lebende Ureinwohner. Heute leben in den Vereinigten Staaten von Amerika wieder etwa 1,5 Mio. Indianer.
Im 18. und 19. Jahrhundert
Anfang des 18. Jahrhunderts umfasste der nordamerikanische Kontinent neben spanischen und französischen Mandatsgebieten auch 13 englische Kolonien. Das Kolonialgebiet erstreckte sich von New Hampshire im Norden bis nach Georgia im Süden. Zwischen den Kolonialmächten Großbritannien und Frankreich kam es zu erheblichen Spannungen. Sie endeten in einem Krieg, der mit dem Siebenjährigen Krieg in Europa von 1756 - 1763 in enger Verbindung steht. Anlass für den auf amerikanischem Boden ausgetragenen Kampf war die Ausbreitung britischer Händler und Siedler über die Appalachen in das von Frankreich beanspruchte Tal des Ohio im Jahre 1754. Dies führte zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Briten, Franzosen und Indianern ("French and Indian War"). Zwischen 1758 und 1760 eroberten die Briten die wichtigsten französischen Stellungen und siegten am 13. September 1759 in der Schlacht auf der Abraham-Ebene bei Québec (Kanada). Nach dem Kriegseintritt Spaniens im Jahre 1761 besetzten Briten Kuba und die Philippinen. Frankreich akzeptierte im Friedensabkommen von Paris ("Pariser Friede") 1763 den Verlust seiner Besitzungen in Nordamerika mit Ausnahme der Inseln Saint-Pierre und Miquelon sowie einiger Inseln der Kleinen Antillen. Großbritannien baute als Ergebnis des Krieges seine führende Rolle als Kolonialmacht aus.
In den folgenden Jahren verschlechterte sich das Verhältnis zwischen dem Mutterland Großbritannien und seinen Kolonien in Nordamerika. Die britische Regierung stationierte stärkere Truppenverbände auf amerikanischem Boden und führte neue Steuergesetze ("Stempelakte" von 1765) ein. Die Kolonisten sahen hierin eine Verschwörung gegen ihre Freiheiten und verfassungsmäßigen Rechte und erwiderten mit Boykott. Es kam zu teilweise gewalttätigen Auseinandersetzungen, die in den Unabhängigkeitskrieg von 1775 - 1783 führten. Am 2. Juli 1776 beschloss der amerikanische Kongress die staatsrechtliche Loslösung der 13 Kolonien von der britischen Krone. Am 4. Juli 1776 folgte die Unabhängigkeitserklärung. Die anfänglich eher schwachen amerikanischen Militärkräfte wurden ab 1778 von Frankreich unterstützt und konnten sich schließlich durchsetzen. Die Anerkennung ihrer Unabhängigkeit erlangte Nordamerika 1783 im Frieden von Paris. Die neuen Verfassungen der aus den Kolonien hervorgegangenen Staaten waren republikanisch und beruhten auf den Prinzipien der Volkssouveränität, der Gewaltenteilung, häufigem Wechsel der Ämter und Einflussnahme der Bürger. Im Jahr 1777 schlossen sich die Staaten zu einem losen Staatenbund (United States) zusammen. 1787 wurde auf dem Konvent in Philadelphia eine neue Verfassung ausgearbeitet. Im Jahr 1789 wurde George Washington zum ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.
Die folgenden Jahrzehnte waren von wirtschaftlichem Aufschwung geprägt. Vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts dehnte das Land seine Grenzen nach Süden, Südwesten und Westen aus. So wurde 1819 Florida, das bis dahin unter spanischer Hoheit stand, in den Staatenbund aufgenommen. Mit der Ausbreitung, die zu starken Siedlungsbewegungen innerhalb des Landes führte, war auch die gewaltsame Vertreibung der Indianer aus dem Gebiet östlich des Mississippi verbunden. Die Verkehrswege wurden ausgebaut, um die Binnenwanderung zu ermöglichen. Ab 1830 begann der Aufbau eines Schienennetzes für die Eisenbahn. In den Südstaaten dehnte sich die Landwirtschaft aus. Insbesondere der Baumwollanbau ("King Cotton" 1855) wurde ausgebaut und mit ihm das System der Sklaverei. In den Nordstaaten entwickelten sich erste Anfänge von Industrie (Textilindustrie, Kohle- und Eisenbergbau).
Zwischen dem Norden und dem Süden des Landes stiegen die Spannungen, vor allem in der Frage der Sklaverei. 1854 wurde die Republikanische Partei gegründet, die sich unter Führung von Abraham Lincoln gegen eine weitere Ausbreitung der Sklaverei wandte. Als Lincoln 1860 zum Präsidenten gewählt wurde, beschlossen elf Südstaaten ihren Austritt aus der Union. Die restlichen Staaten bestritten unter Berufung auf die Unauflösbarkeit der bundesstaatlichen Verfassung das Recht auf einen solchen Austritt. 1861 griffen die Südstaaten das Fort Sumter in Charleston an und lösten damit den amerikanischen Bürgerkrieg aus. Dieser endete 1865 mit der Kapitulation der Südstaaten, die Einheit war wiederhergestellt und die Sklaverei wurde abgeschafft. Es entwickelte sich jedoch ein zunehmend gewalttätiger Rassismus gegen die schwarze Bevölkerung, in dessen Zuge der Ku Klux Klan entstand.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Erschließung des kontinentalen Siedlungsgebietes der USA abgeschlossen. Mit der Ausrottung der großen Bisonherden durch den Eisenbahnbau wurde die Lebensgrundlage der Prärie-Indianer zerstört. Sie wurden in Reservate westlich des Mississippi gedrängt. Ihre letzte große Schlacht gewannen die Ureinwohner 1876 am Little Bighorn. 1886 bzw. 1890 unterwarfen sich mit den Apachen unter Häuptling Geronimo und den Sioux die letzten Stämme den ehemaligen Kolonisten.
Industrialisierung und Urbanisierung des Landes schritten fort. Während 1880 noch 28% der Amerikaner in Städten lebten, waren es um 1900 bereits 40%. Die Bedeutung der Landwirtschaft ging zurück. Außenpolitisch strebte die USA mehr und mehr nach dem Status einer Weltmacht. Der Spanisch-Amerikanische Krieg 1898, in dem sich die USA die Vormachtstellung im karibischen Raum sicherten, aber auch die durch Franklin Roosevelt initiierte Vermittlung des russisch-japanischen Friedens von 1905 sind Beispiele dafür.
Im 20. Jahrhundert
Zu Beginn des Ersten Weltkrieges verfolgten die USA zunächst eine Politik der Neutralität mit dem Ziel der Vermittlung. Als Deutschland 1917 jedoch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg wieder aufnahm, traten die Vereinigten Staaten in den Krieg an der Seite der Alliierten ein. Ein Beitritt der USA zum Völkerbund (Versailler Vertrag) 1920 als Ergebnis des Krieges scheiterte am innerpolitischen Widerstand.
In den 1920er Jahren erlebte das Land große wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme. Religiöser Fundamentalismus und Rassenhass prägten das geistige Klima. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 - 1932 erreichte auch die USA. So schrumpfte innerhalb weniger Jahre die Industrieproduktion auf 58%.
Nach dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und des Faschismus in Italien bemühte sich Präsident Roosevelt 1939/40 um die Unterstützung der westlichen Demokratien im Kampf gegen den Faschismus. Nach dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 entschloss sich die USA zum Eintritt in den Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute
Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die USA ihre Stellung als politische und wirtschaftliche Weltmacht festgeschrieben. Die Zeit danach ist von zahlreichen militärischen und politischen Konflikten mit Ländern rund um den Globus geprägt. Unter Präsident Harry S. Truman verschärfte sich Ende der 1940er Jahre der Ost-West-Konflikt zum Kalten Krieg. Außen- und innenpolitisch verfolgten die USA seit dieser Zeit eine stark antikommunistische Haltung. So unterstützte die CIA eine Invasion von Exilkubanern gegen das Revolutionsregime von Fidel Castro in Kuba. Der Aufstand scheiterte am 17. April 1961 in der Schweinebucht. Im Oktober 1962 kam es zur Kubakrise, bei der die beiden Supermächte USA und Sowjetunion kurz vor dem Einsatz von Nuklearwaffen standen. Nie zuvor in der Weltgeschichte war ein Atomkrieg so wahrscheinlich wie zu diesem Zeitpunkt. 1964 traten die USA in den Krieg in Vietnam ein, der bis 1973 dauerte und zehntausende Opfer auf beiden Seiten kostete In den USA selbst führte der Kampf um die Gleichstellung der afroamerikanischen Bevölkerung 1954 zur Aufhebung der Rassentrennung an Schulen und erreichte in den 1960er Jahren unter Führung Martin Luther Kings seinen Höhepunkt.
Ab Oktober 1973 rückte - ausgelöst durch den Jom-Kippur-Krieg - zunehmend die Krisenregion des Nahen und Mittleren Ostens in das Zentrum der amerikanischen Aufmerksamkeit. Währen der zweiten Amtszeit Ronald Reagans als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kam es vor dem Hintergrund der von UdSSR-Präsident Michael Gorbatschow betriebenen neuen Politik der sozialistischen Länder zu einer Entspannung im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis. Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten im Oktober 1990 und dem Zerfall der UdSSR 1991 endete der Kalte Krieg. Seitdem gelten die USA als einzige verbliebene Weltmacht.
Im Jahr 2000 kam George Walker Bush (geb. 1946) als Präsident an die Macht. Seine Vereidigung fand am 20 Januar 2001 statt. Unter seiner Präsidentschaft kam es zum am 11. September 2002 zum Anschlag auf das World Trade Center in New York und im Anschuss daran zum Einmarsch in den Irak mit den bekannten Folgen. Bush war sicherlich einer der umstrittensten Präsidenten in der Geschichte der USA. Unter seiner Regierung erlebte das Land einen moralischen und wirtschaftlichen Niedergang wie kaum sonst in Nichtkriegsjahren zuvor. Außerdem war er in Europa seit dem 2. Weltkrieg einer der unbeliebtesten Präsidenten den das Land hatte.
Am 20. Januar 2009 legte Barack Hussein Obama seinen Amtseid in Gegenwart von über zwei Millionen Menschen in Washington ab und trat damit offiziell sein Amt als der 44. Präsident der USA an.